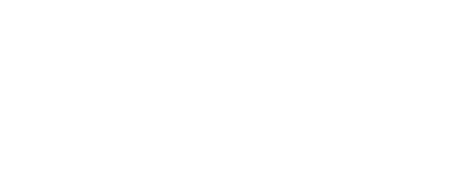Atomare Endlagerung
Atomstrom ist keine Alternative

Ausgangssituation
Nach dem Super-Gau von Fukushima 2011 entschied sich Deutschland aus der Atomkraft auszusteigen. Doch so leicht werden wir das strahlende Erbe nicht los. Einige radioaktive Gifte wie Jod-129 haben eine Halbwertszeit von 15 Millionen Jahren. Und neben dem aufwendigen und teuren Rückbau der Kraftwerke steht das ungelöste Problem: Wohin mit dem Atommüll? Ende September 2022 kam das überfällige Aus für das Endlager in der Asse bei Gorleben (Niedersachsen). Damit beginnt aber auch die Suche auf’s Neue.
In Thüringen sind wir mit den Hinterlassenschaften der Wismut bereits massiv durch strahlenden Abfall vorbelastet. Hinsichtlich der Endlager-Frage werde ich mich auch weiterhin dafür einsetzen, dass alle möglichen Standorte in Deutschland intensiv geprüft werden, um den geologisch sichersten Ort zur Endlagerung des Atommülls zu ermitteln.
Sofern mehrere Regionen mit vergleichbaren Voraussetzungen vorliegen, müssen gerade solche Bundesländer, in denen AKWs betrieben und dort Profite eingefahren wurden, besonders in die Entscheidung einbezogen werden. Die dafür zuständige Bundesgesellschaft für Endlagerung veröffentlichte einen Zwischenbericht zu Teilgebieten in Deutschland, die im nächsten Schritt verglichen werden, um im Ausschlussverfahren die geeignetsten Gebiete für das Endlager zu finden. Seit dem werden wir deutschlandweit mit Fragen und Ängsten konfrontiert.
Meine Forderungen
1.
Kein Bundesland darf sich aus der Verantwortung stehlen.
Wichtig ist eines: Wir lehnen das „Sankt-Florians-Prinzip“ ab. Das bezeichnet Verhaltensweisen, potentielle Bedrohungen oder Gefahrenlagen nicht zu lösen, sondern auf andere zu verschieben. „Nimby“ wird das im internationalen Jugendsprech genannt, ein Akronym für „Not in my backyard“ (nicht in meinem Hinterhof). Nach dieser Devise agiert aber Bayerns Ministerpräsident, Möchtegerngeologe Markus Söder. Der CSU-Politiker erklärt einfach sein Bundesland für ungeeignet.
2.
Thüringen und der Osten dürfen nicht zur atomaren Resterampe werden.
In Thüringen kommen nach aktuellem Stand mehr als drei Viertel der Landesfläche infrage. Laut Standortauswahlgesetz geht es dabei ausschließlich um geologische Aspekte. Schon der Fall Gorleben spricht aber eine andere Sprache. Während des Kalten Krieges war es ein Leichtes, das „Zonenrandgebiet“ für das Endlager Asse auszuwählen. Am Ende entscheidet der Bundestag und da geht es schlicht und einfach um Mehrheiten. Thüringen hat 22 Abgeordnete, Bayern 108 und der Bundestag muss sich nicht an die Empfehlungen der Bundesgesellschaft für Endlagerung halten. Die endgültige Entscheidung steht allerdings erst 2031 an und es könnte auch noch länger dauern. Bis zur Fertigstellung des Endlagers werden wir uns schon im Jahr 2050 befinden.